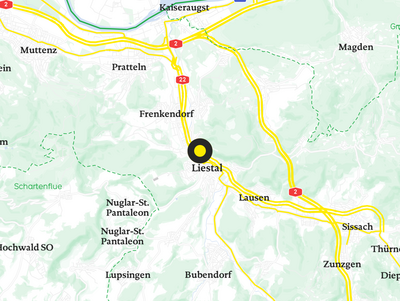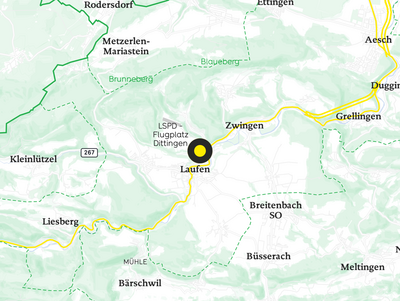Internistische Studien
Aktuelle Studien
Diese Studie ist eine Beobachtungsstudie, die sich mit Patienten beschäftigt, die an chronischer Nierenerkrankung (CKD) und Typ-2-Diabetes (T2D) leiden und mit Finerenon (KERENDIA®) behandelt werden. Der primäre Zweck dieser Studie besteht darin, die Behandlungsmuster von Personen mit CKD und T2D zu untersuchen, die entweder kürzlich mit der KERENDIA®-Therapie begonnen haben oder dies in naher Zukunft tun werden. Diese Therapie wird von ihrem behandelnden Arzt im Rahmen der regulären medizinischen Versorgung empfohlen und verschrieben.
Status
Rekrutierung abgeschlossen
Studienleitung
Dr. med. Felix Burkhalter Pirovino, Leitender Arzt, Leiter Nephrologie
Studienbeteiligte
Dr. med. Cédric Jäger, Leitender Arzt
Dr. med. Yvonne Holzmann, Oberärztin
Dr. med. Christoph Lenherr Leitender Arzt
Dr. med. Dr. phil. nat. Katrin König, Leitende Ärztin
Andrea Kloetzer Study Nurse
Interdisziplinäre Sprechstunde für Langzeitnachsorge
Das KSBL bietet Langzeitüberlebenden nach onkologischen Erkrankungen im Kindes- oder Jugendalter spezielle Interdisziplinäre Sprechstunden für Langzeitnachsorge an. Dabei erstellen unsere Spezialisten einen auf die Patientin/den Patienten zugeschnittenen Nachsorgeplan, der die aktuellsten Empfehlungen für die lebenslange Nachsorge enthält.
Status
Patientinnen und Patienten werden aufgenommen
Studienleitung
Prof. Dr. med. Jörg Leuppi, Chief Medical Officer
Dr. med. Eva Maria Tinner, Pädiatrische Onkologin
Studienbeteiligte
Dr. med. Fabian Meienberg, Leiter Endokrinologie & Diabetologie
Sabrina Maier, Study Nurse
Rolle der Prostaglandine in der Vorhersage eines tiefen Salzspiegels unter Thiazid- Therapie
Diese Studie richtet sich an volljährige ambulante und hospitalisierte Patienten, welche neu ein Thiazid- oder Thiazid-ähnliches Diuretikum verschrieben bekommen.
Thiazid- und Thiazid-ähnliche Diuretika sind harnausscheidende Medikamente (sogenannte «Wassertabletten»). Eine häufige Nebenwirkung von Thiazid- Diuretika ist ein erniedrigter Salzspiegel im Blut. Aktuell gibt es keine bekannte Vorsorgeuntersuchung, um ein erhöhtes Risiko für diese Nebenwirkung schon vor Beginn der Therapie erkennen zu können. In unserem Forschungsvorhaben wollen wir daher herausfinden, ob vor Beginn der Therapie die Bestimmung der Prostaglandin E2- Konzentration im Urin (Gewebshormon) das Auftreten eines erniedrigten Salzspiegels im Blut hervorsagen kann.
Status
Patientinnen und Patienten werden aufgenommen
Studienleitung
Dr. med. Felix Burkhalter Pirovino, Leitender Arzt, Leiter Nephrologie
Studienbeteiligte
Daniela Felber-Gredig, Study Nurse
Bei der MILOS-Studie handelt es sich um eine praxisnahe Untersuchung des Einsatzes von Bempedoinsäure zur Behandlung hoher Cholesterinwerte. Es hat sich gezeigt, dass Bempedoesäure (Nilemdo®) und ihre fest dosierte Kombination mit Ezetimib (Nustendi®), mit oder ohne andere Lipidtherapien, bei Patienten mit Hypercholesterinämie oder gemischter Dyslipidämie zu einer signifikanten Senkung des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterinspiegels (LDL-C) führt.
Status
Rekrutierung abgeschlossen.
Studienleitung
Dr. med. Felix Burkhalter Pirovino, Leitender Arzt, Leiter Nephrologie
Studienbeteiligte
Dr. med. Cédric Jäger, Leitender Arzt
Dr. med. Yvonne Holzmann, Oberärztin
Dr. med. Christoph Lenherr Leitender Arzt
Dr. med. Dr. phil. nat. Katrin König, Leitende Ärztin
Andrea Kloetzer Study Nurse
Cortisolbehandlung ausschleichen oder direkt stoppen?
Prednison und andere synthetisch hergestellte Cortisol-ähnliche Medikamente werden zur Entzündungshemmung bei einer Vielzahl von Krankheiten in Tablettenform oder als Injektionen verabreicht. Diese Therapie hat jedoch viele unerwünschte Arzneimittel-Wirkungen. Eine oft beobachtete Nebenwirkung von Prednison ist die Unterdrückung der körpereigenen Produktion von Cortisol. Dieser Effekt dauert über das Beenden der Prednison Therapie hinaus an.
Sind die bei der Patientin oder beim Patienten gemessenen Cortisolspiegel erniedrigt, wird Prednison aktuell nicht abrupt abgesetzt, sondern die Dosis in kleinen Schritten reduziert, bevor es nach Wochen schliesslich ganz gestoppt wird. Dieses Vorgehen ist zwar medizinisch einleuchtend, wissenschaftlich bislang aber nicht belegt. Es gibt keine Daten aus kontrollierten Studien zur Frage, ob und wie Glucocorticoide ausgeschlichen werden sollen.
Diese multizentrische Studie prüft deshalb die Hypothese, ob auch nach längerer Behandlungsdauer mit Prednison®, Spiricort® oder einem verwandten Produkt auf ein langsames Ausschleichen der Dosis verzichtet werden darf, ohne dass dadurch ein schlechterer Verlauf resultiert. So könnten eine unnötige Verlängerung dear Behandlung und allfällige unerwünschte Nebeneffekte vermieden werden.
Die Studie wird vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.
Status
Patientinnen und Patienten werden aufgenommen
Studienleitung
Prof. Dr. med. Jörg Leuppi, Chief Medical Officer
Studienbeteiligte
Helga Schneider, Study Nurse
Studienarchiv
Anpassung des Schwellenwertes für D-Dimere mit zunehmenden Alter für den Ausschluss von tiefer Venenthrombose: Eine prospektive Studie. Ziel dieser Studie ist es, zu bestätigen, dass die Verwendung des neuen altersabhängigen Schwellenwerts für D-Dimere bei Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf tiefe Venenthrombose sicher ist.
Status
abgeschlossen
Studienbeteiligte
Prof. Dr. Marc Righini, HUG
Clinical Research from multi-modality big data sources without proprietary interfaces in a multicenter approach.
Das CREATE-System ist ein innovativer Ansatz zur Verwaltung komplexer, unstrukturierter Daten. Das Projekt ermöglicht die Interoperabilität zwischen Systemen und Organisationen sowie den Austausch landesweiter klinischer Routinedaten, welche für die Forschung zugänglich sein werden.
Das Projekt wird von einem Konsortium durchgeführt: Kantonsspital Baselland (KSBL), Kantonsspital Aarau (KSA), Kantonsspital St. Gallen (KSSG) und Ente Ospedaliero Cantonale Bellinzona (EOC) unter der Leitung von Prof. Dr. med. Jörg Leuppi.
Ein Vorteil der CREATE-Architektur besteht darin, dass Daten nicht kopiert oder verschoben werden. Daten bleiben immer in ihrem ursprünglichen sicheren Speicherort mit den entsprechenden Richtlinien. Suchen und Algorithmen werden auf die Daten angewendet. Teure Schnittstellen werden drastisch reduziert und teilweise sogar vollständig abgeschafft.
Darüber hinaus gewährleistet das System Datensicherheit auf höchstem Niveau durch sichere Übertragungstechnologie, Verschlüsselung und automatisierte Anonymisierung sowie Depersonalisierung auf Basis erstklassiger Lösungen aus dem Schweizer Gesundheitswesen.
Das CREATE-System ermöglicht die Erfassung grosser Datenmengen, die auf personalisierte Weise verfügbar sind, den Zugriff und die Verwendung unstrukturierter routinemässiger medizinischer und administrativer Daten aus dem Gesundheitswesen. Aufgrund des grossen Datenvolumens, das für die personalisierte Gesundheitsforschung zur Verfügung stehen wird, erwarten wir ausserdem, seltene Zustände und Ereignisse aussagekräftig untersuchen zu können.
Weitere Projekte
CREATE COPD-Analyse
CREATE DECODE
CREATE Heart failure
Status
abgeschlossen
Studienleitung
Prof. Dr. med. Jörg Leuppi, Chief Medical Officer
Studienbeteiligte
Dr. sc. med. Giorgia Lüthi-Corridori, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Intensivierte Korrektur des Natriumspiegels bei hospitalisierten Patienten mit Hyponaträmie – eine prospektive internationale randomisierte Studie.
Die HIT-Studie ist eine internationale Studie mit verschiedenen Zentren in der Schweiz, in Deutschland, Kroatien, Italien und Holland.
Die Hyponaträmie ist die häufigste Elektrolytstörung, sie kann verschiedene Ursachen mit entsprechend unterschiedlicher Behandlung je nach Auslöser haben. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Hyponaträmie mit vermehrten klinischen Komplikationen, Spitalaufenthalten sowie vermehrter Sterblichkeit einhergeht. Trotz dieser Ergebnisse ist bis heute nicht klar, ob eine gezielte Behandlung der Hyponaträmie zu weniger Komplikationen sowie tieferer Sterblichkeit führt.
- Ziel der Studie: Hierbei wird untersucht, ob eine gezielte Anhebung des Natrium-Spiegels im Blut im Vergleich zur bisherigen Standardbehandlung zu weniger Komplikationen und erneuten Hospitalisationen sowie tieferer Sterblichkeit führt.
- Einschlusskriterium: Hospitalisierte Patienten mit hypoosmolarer Hyponatriämie <130mmol/l
- Ausschlusskriterien: Hyponatriämie auf Grund entgleistem Diabetes mellitus, palliative Therapie, Schwangerschaft
Die eingeschlossenen Patienten werden in 2 Behandlungs-Gruppen unterteilt: In A) Intervention (Diagnostik u. Therapie forciert durch Studienteam) und B) Standard-Therapie (Diagnostik u. Therapie gemäss bestehenden Standards).
Status
abgeschlossen
Studienleitung
Prof. Dr. med. Jörg Leuppi, Chief Medical Officer
Studienbeteiligte
Daniela Felber-Gredig, Study Nurse