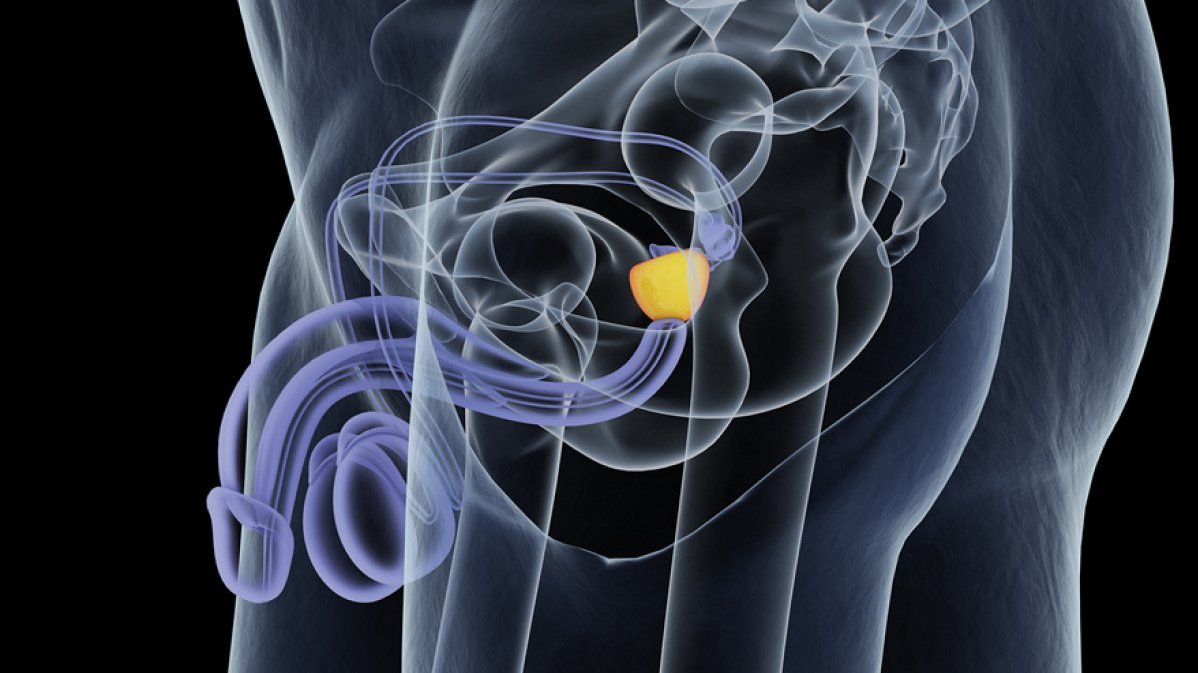Palliative Care: Höchstmögliche Lebensqualität
Schon seit einem Jahr lebte Ingrid F.* mit dem Krebs, der mit der Zeit im ganzen Körper gestreut hatte. Als sich der Zustand der Rentnerin verschlechterte, mussten neue Untersuchungen durchgeführt und die Betreuung intensiviert werden. Nach Absprache mit ihrem Hausarzt begab sie sich dafür ins Kantonsspital Baselland (KSBL). Bereits von Anfang an zog ihr Behandlungsteam den palliativen Konsildienst bei. In einem ausführlichen Gespräch mit der Leitenden Ärztin Dr. Christine Zobrist und einer Pflegefachfrau erzählte sie über ihre Beschwerden. «Viele denken bei einer Mitbetreuung durch die Palliative Care, sie seien hoffnungslose Fälle und man könne nichts mehr machen. Doch das Gegenteil trifft zu», erzählt Dr. Zobrist. Das wichtigste Therapieziel von Palliative Care ist, Menschen mit einer unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Erkrankung zu einer möglichst guten Lebensqualität zu verhelfen. So standen bei Ingrid F. an erster Stelle die Bekämpfung der Schmerzen und der Schlaflosigkeit. Die weiteren Therapie- und Behandlungsschritte erfolgten in enger Zusammenarbeit zwischen dem Stations- und dem Palliativteam. Für die Behandlung ihrer stärker werdenden Atemnot wurde die Physiotherapie mit einbezogen. Die 71-Jährige war zudem froh, dass ihr die Psychoonkologin gemeinsam mit dem Palliativteam beistanden, wenn sie mit ihrem Schicksal rang. So ging es ihr Schritt für Schritt wieder etwas besser, sodass sie gemeinsam mit ihren Angehörigen und der spitalexternen Onkologie- und Palliativpflege Baselland (SEOP BL) die Rückkehr nach Hause vorbereiten konnte. Ein grosser Wunsch von Ingrid F. war es, mit ihrem Mann Zeit in der Ferienwohnung verbringen zu können und ihren Hund bei sich zu haben. Dies liess sich dank einer umsichtigen Organisation der gesundheitlichen Versorgung erfüllen. Zwei Monate später verstarb Ingrid F. in einem Hospiz. «Trotz ihrer schweren Erkrankung hatte sie im letzten Lebensjahr auch gute und wertvolle Momente», sagt Dr. Zobrist rückblickend.
Ganzheitlich und selbstbestimmt
Das Beispiel von Ingrid F. zeigt anschaulich, wie Palliative Care die Selbstbestimmung schwerkranker Menschen fördern kann. Dabei handelt es sich um einen ganzheitlichen, interdisziplinär ausgerichteten Ansatz. So arbeiten nebst der Medizin, Pflege, Physiotherapie und Psychoonkologie weitere Berufsgruppen wie der Sozialdienst, die Ernährungsberatung sowie die Seelsorge am KSLB Hand in Hand. Die Betreuung orientiert sich laut Dr. Zobrist an den Beschwerden und Bedürfnissen der erkrankten Personen. Deshalb sei wichtig, der Patientin oder dem Patienten gut zuzuhören, um zu erkennen, was die Erkrankten belastet oder ängstigt, was für sie unterstützend ist und wie sie die verbleibende Zeit gestalten möchten. «Aufgrund der geschilderten Patientengeschichte können wir einen massgeschneiderten Behandlungsplan erstellen.» Bei der Palliativmedizin gehe es nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Diese Aussage stammt von der Pionierin dieses Gebiets, der Britin Cicely Saunders. In dem von ihr gegründeten St Christopher’s Hospice in London absolvierte Dr. Zobrist einen Teil ihrer Palliative-Care-Ausbildung.
Was ist Palliative Care?
Die palliative Medizin umfasst Massnahmen, die helfen, unnötige Leiden und Komplikationen bei schwerkranken Menschen vorzubeugen oder zu lindern. Die Basis von Palliative Care ist eine ganzheitliche Sicht auf die Patientensituation. Am KSBL kann eine Mitbetreuung durch die Palliative Care stationär (Konsildienst) oder ambulant (SEOP) erfolgen. Dabei arbeiten verschiedene Fachkräfte interdisziplinär zusammen, um der Patientin oder dem Patienten die Symptome zu lindern und in der jeweiligen Situation eine höchstmögliche Lebensqualität
zu schenken.
Das Angebot der Palliative Care am KSBL umfasst:
- Begleitung unheilbar kranker Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen
- Erfassen von Bedürfnissen und Ressourcen körperlicher, spiritueller, sozialer oder psychischer Art
- Behandlung von Beschwerden wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst
- Unterstützung bei der Formulierung des Therapieziels
- Erstellen eines Notfallplans, Unterstützung beim Verfassen einer Patientenverfügung
- Beratung bei der Planung des weiteren Prozederes
- Konsildienst für das stationäre Behandlungsteam
- Spitalexterne Onkologie- und Palliativpflege (SEOP)

Über das Sterben reden
In diesem Film erfahren Sie, was Palliative Care bedeutet. Er regt dazu an, über das Sterben zu sprechen und informiert, weshalb gesundheitliche Vorausplanung wichtig ist:
youtu.be/1o6USAKeOHA

Vom 14. – 20. November findet die Palliative Woche statt. Besuchen Sie am 17. November 2022 den Vortrag des KSBL zum Thema «Reden wir über das Sterben – Palliative Care und Advance Care Planning»
www.ksbl.ch/veranstaltungen

Dr. med. Christine Zobrist ist Leitende Ärztin Palliativmedizin am Kantonsspital Baselland. Sie schloss den Studiengang Palliative Care 2014 mit dem Master of Science erfolgreich ab. Zudem ist sie seit 2019 Trägerin des Fähigkeitsausweises «Interdisziplinärer Schwerpunkt Palliativmedizin».
Kantonsspital Baselland
Medizinische Universitätsklinik
Palliative Care
T +41 (0)61 553 73 28
palliativecare@ksbl.ch
www.ksbl.ch/palliativecare
Ber Beitrag ist in der November-Ausgabe des Magazins Regio aktuell erschienen.